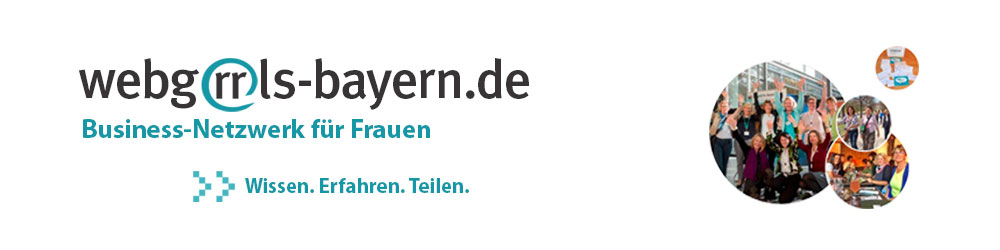Wir ärgern uns schwarz und haben eine weiße Weste. Wir sprechen von gutem Wetter, wenn die Sonne scheint, und von schlechtem Wetter, wenn es regnet. Aber wer sagt eigentlich, dass Sonne besser ist als Regen? Die Natur braucht beides. Wir (be)nutzen die Sprache meist, ohne darüber nachzudenken, warum wir etwas genau so sagen, wie wir es sagen. Dabei lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Dr. Eva Maria Graf und Cornelia Rüping haben uns in ihrem Vortrag gezeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, die Worte und ihre Wirkung zu hinterfragen.
„Stories are the secret reservoir of values: change the stories that individuals or nations live by and you change the individuals and nations themselves.“
Stories-we-live-by
Mit diesem Zitat des Schriftstellers Ben Okri führte uns die Sprachwissenschaftlerin Dr. Eva Maria Graf in das Thema des Vortrags ein und macht damit gleich zu Anfang deutlich, welch tiefe Bedeutung die Sprache in einer und für eine Gesellschaft hat. Die Art und Weise, wie wir über Dinge reden, bestimmt unser Handeln und kann sich in der Folge positiv, aber auch schädlich für die Umwelt, für die Tiere, für uns selbst auswirken. Tatsächlich nehmen wir die Narrative oder die Geschichten, die wir als Einzelne, als Gruppe oder auch als Gesellschaft in uns tragen, als naturgegeben an, wir hinterfragen sie nicht und so beeinflussen sie, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, unser Fühlen, Denken und Handeln. Die Sprache und die Art und Weise, wie wir sprechen und wie wir Sprache verwenden, beruht auf sozial konstruierten Schablonen, durch die wir die Welt auf eine bestimmte Art und Weise kategorisieren und auch bewerten. Wenn wir das begreifen, können wir Sprache bewusst einsetzen, nicht um zu manipulieren, aber wir können das Bild von uns und davon, wie wir uns zur Umwelt verhalten, bewusst positiv verändern. So gehen wir unbedacht von der Annahme aus, dass „die Natur dem Menschen untertan ist“. Nehmen wir das als gegeben hin und drücken es so in unserer Sprache aus, implizieren wir, dass wir Menschen die Natur ausbeuten (dürfen) und uns über der Natur stehend sehen. In unserer Zeit durchaus ein Gedanke, den es zu überdenken und umzudeuten gilt.
Was ist Diskurs?
In der Sprachwissenschaft spricht man in diesem Zusammenhang vom Diskurs. Als Diskurs bezeichnet man einen einzelnen Text oder auch ein einzelnes Bild. Der Diskurs ist eine diskursive Praktik, also zum Beispiel ein immer wiederkehrender Slogan, ein immer wiederkehrendes Sprachgefüge. Als Diskurs bezeichnet man aber auch soziale Praktiken, die wir als Gesellschaft oder zumindest als Gruppierung innerhalb einer Gesellschaft teilen. Sie existieren nicht einfach so, sondern werden von uns ins Leben gerufen oder zumindest immer wieder bestärkt und formen systematisch die Objekte, über die wir sprechen. Das bedeutet auch, dass Dinge, die wir noch nicht benannt haben, quasi nicht existieren. So litten beispielsweise die meisten Männer, die aus dem Zweiten Weltkrieg nach Haus kamen, unter posttraumatischen Erschöpfungsstörungen. Da es dieses Wort und das Wissen um diese Störung noch nicht gab, konnte sie nicht als solche besprochen und schon gar nicht behandelt werden.
Wir nehmen die Welt durch bereits existierende Diskurse wahr. Das ist wichtig zu verstehen und zu durchschauen, weil in unseren Gesellschaften Macht und Kontrolle durch sagen, schreiben und meinen ausgeübt wird, von Expert:innen, Politiker:innen oder Meinungsmacher:innen und ihren Definitionen, Beschreibungen und Klassifizierungen. Das zeigt sich etwa auch im uns global begleitenden Diskurs vom Benefit des Wirtschaftswachstums. In unzähligen Texten und internationalen Kontexten wird die Botschaft verbreitet, dass Wachstum gut und notwendig ist. Im Zusammenhang mit Wachstum werden positiv konnotierte Begriffe wie „Steigerung“, „Größe“ oder „Wirtschaftsleistung“ verwendet. So wird durch die Sprache suggeriert, dass viel besser ist als wenig, viel Konsum, viel Absatz, die Absatzzahlen steigen, die Löhne gehen nach oben, groß ist besser als klein etc.
Ähnliches zeigt sich im Verhältnis von Lebewesen und Ökosystemen, das geprägt ist vom Anthropozentrismus, also dem Glauben und der Annahme, dass der Mensch im Zentrum des Universums stünde und alles um ihn herum von ihm kontrollierbar sei. Beispiele aus der täglichen Sprache verdeutlichen das. So ist es etwa ein Unterschied, ob wir von Wald, Bäumen oder von Nutzholz sprechen. Mit Letzterem betonen wir den Benefit, den der Mensch aus der Natur zieht. Ähnliches zeigt sich, wenn wir von Tier, Haustier, Nutztier oder Schädling sprechen. Auch damit kategorisieren wir ein Tier aus der Perspektive des Menschen mit Begrifflichkeiten, deren wahre Bedeutung wir oft gar nicht mehr infrage stellen.
Sprache gibt die Realität wider und gestaltet sie
Es gibt viele sprachliche Beispiele, die bestimmte Werte und Vorstellungen transportieren und die wir nicht hinterfragen. Etwa das Konzept des „Familienvaters“, während es den Begriff der „Familienmutter“ nicht gibt, wohl aber das Wort „Muttertier“, das das Bild des Säugens, Gebärens und Sich-Kümmerns impliziert. Oder die „Muttersprache“, was suggeriert, dass Frauen für die Sozialisierung und die Kommunikation zuständig sind. Hier könnte man etwa von „Erstsprache“ sprechen, um dieses Bild aufzulösen. Andere Beispiele sind Fußball und Frauenfußball: Es ist die Norm, dass Männer Fußball spielen, wenn es um Frauen geht, muss das extra benannt werden. Die Sprache und die Begrifflichkeiten liefern Bedeutungen immer implizit mit. Das gilt auch für Bilder. Wenn man den Begriff „Beziehung“ in eine Suchmaschine eingibt, finden sich vor allem Repräsentationen von heterosexuellen Paaren und keine Darstellung homosexueller oder sexuell anders orientierter Menschen. Fast immer ist zudem der Mann größer als die Frau, die sich wiederum schutzsuchend an ihn schmiegt.
Ein weiteres Beispiel sind die Begriffe „Klimawandel“, „Klimakrise“ oder „globale Erwärmung“. Der Begriff „Klimawandel“ klammert die menschliche Verantwortung für diese Entwicklung vollkommen aus, denn Dinge wandeln sich (von ganz allein).
Das Konzept der Metapher
Dr. Eva Maria Graf erwähnt auch das Konzept der Metaphern. In diesem Fall nicht verstanden als literarische Phänomene, sondern als Denkphänomene, die sich in der Sprache bilden und als mentale Brücken dienen, die es uns erlauben, als Mensch in einer extrem komplexen Umwelt Fuß zu fassen und uns zurechtzufinden. Beispiele für Metaphern, die wir häufig gar nicht mehr als solche wahrnehmen, sind etwa „sie verschwenden meine Zeit“, „Zeit ist Geld“. Oder die der Natur als Warenhaus, wenn wir davon sprechen, dass die Natur uns Dinge „liefert“. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch implizite Evaluierungen. So sind die Begriffe „frisch“, „vital“, „innovativ“, „nachhaltig“ oder „bio“ per se keine positiven Begrifflichkeiten, aber im Rahmen bestimmter Diskurse positiv konnotiert.
Wer schreibt?
Cornelia Rüping beschäftigte sich im Anschluss mit der Frage, was diese theoretischen Ansätze für das Verfassen verschiedener Texte – von der Aktennotiz bis hin zum Buch – bedeuten. Als Schreibende:r bin ich immer auch Teil einer Gruppe, eines Teams, einer Gesellschaft und benutze Narrative, die die soziale Wahrnehmung steuern. Wenn ich schreibe, so ihre Überlegung, kann ich mir zuvor für den bewussten Umgang mit der Sprache einige Fragen stellen. Fragen über mich selbst, etwa: Wie schätze ich mich ein? Wo stehe ich und was ist meine Geschichte? Was ist meine berufliche Identität, mein Wissen, meine Erfahrung? Was ist mein sozialer Hintergrund? Was möchte ich meinen Leser:innen mitgeben und was bewirken? Die Antworten auf diese Fragen zeigen mir, aus welchem Umfeld ich komme und welchen Unterbau ich habe. Das ermöglicht mir, mich zu verändern und Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen.
Für wen schreibst du?
Wichtig ist außerdem die Frage nach meinem Gegenüber. Für wen schreibe ich, wer ist meine Zielgruppe und wie sieht ihre Welt aus? Spricht sie meine Sprache und teilt sie meine Werte? Erst wenn ich weiß, wie die Welt meines Gegenübers aussieht, kann mein Text ihn erreichen. Wir alle kennen das, wenn wir etwas lesen, uns angesprochen fühlen von einem Text und förmlich in ihn eintauchen. Das gelingt nur, wenn die Autorin oder der Autor unsere Welt durchdrungen hat und weiß, wie sie oder er für mich schreiben muss. Kommunikationssysteme, die nicht übereinstimmen, führen zu Missverständnissen oder es kommt erst gar nicht an, was die Autor:innen aussagen wollte. Cornelia Rüping erwähnte in diesem Zusammenhang auch Klischees und warf die Frage auf, ob man sie verwenden sollte oder nicht. Auch sie funktionieren nur, wenn meine Zielgruppe sie versteht. Wenn ich etwa von jemandem spreche, der „rot wie eine Tomate geworden ist“, hat in der Regel jeder sofort ein Bild im Kopf und weiß, was ich damit ausdrücken möchte, ohne dass ich es umständlich umschreiben muss. Andere Klischees mögen plump oder unangebracht erscheinen.
Die eigene Haltung
Bevor ich mit dem Schreiben beginne, empfiehlt es sich auch, mich als Autor:in zu fragen, welche Haltung ich einnehmen will. Bin ich die Allwissende und stehe über den Dingen oder nehme ich mich zurück und stelle das Wissen in den Vordergrund? Nehme ich meine Leser:innen an die Hand oder nehme ich mich als Autor:in komplett raus?
Die Macht der Worte
Dr. Eva Maria Graf und Cornelia Rüping haben uns einen faszinierenden Einblick in Wortsinn und Wortbedeutungen gegeben und gezeigt, dass sich der bewusste Umgang mit Sprache lohnt. Nicht zuletzt auch, wenn wir an Begriffe wie die „Macht der Worte“ oder „wortgewaltig“ denken, wird deutlich, dass wir mit Sprache kritisch umgehen müssen. Wir sollten hinterfragen, was wir sagen und schreiben oder welche Bilder wir benutzen und uns ihre Wirkung bewusst machen. Über alledem darf aber nicht die Schönheit von Sprache vergessen werden und das ästhetische oder gar sinnliche Erlebnis, das ein schöner Text vermitteln kann. Oder, um es mit Cornelia Rüping zu sagen, lasst uns nicht einfach einen Kaffee trinken, sondern eine heiße Latte Macchiato mit einer schönen, duftigen, weißen Schaumkrone genüsslich durch einem Trinkhalm schlürfen.
Die Referentinnen
Prof. Dr. Eva-Maria Graf ist Professorin für Angewandte Sprachwissenschaft an der Alpen-Universität Klagenfurt, zudem Coach und Trainerin unter anderem im Bereich Frauen in der Wissenschaft, Gendersensibilität und Diversität. Besonders wichtig ist ihr dabei, zwischen Wissenschaft und Praxis zu vermitteln.
Mehr unter: www.aau.at/team/graf-eva-maria
d
Cornelia Rüping ist Autorencoach und Sachbuchlektorin. Seit über 20 Jahren bearbeitet, verfasst und konzipiert sie Texte unterschiedlichster Art. Zudem unterstützt sie Menschen, die ihre Gedanken zu Papier bringen wollen, beim Konzepterstellen, während des Schreibprozesses und dabei, ihren persönlichen authentischen Schreibstil zu finden.
Mehr unter: www.traum-vom-buch.de
Text: Heike Papenfuss, www.medienbueropapenfuss.de
Fotos: Mandy Ahlendorf, www.ahlendorf-communication.com
Abbildungen in Präsentation: pixabay.de (Mohamed Hassan, Open Clipart-Vectors, Gerd Altmann, Clker-Fee-Vector-Images, TukTuk Design)